von Till Briegleb (16/1)
Pretty Ugly? Das ist jeden Tag eigentlich mehr die Beschreibung unseres ästhetischen Gesamtzustands, denn eine Ehrenrettung der Hässlichkeit. Extrem beschleunigt seit dem Zusammenbruch des Kommunismus vor 25 Jahren, erlebt die wohlhabende Welthälfte mit ihrem enormen Verbrauch an Reizen eine fundamentale Krise des Schönen. Getrieben vom zwanghaften Anspruch, das Hässliche zu verbergen, hat die konsumistische Verschleierung alle Lebensbereiche dogmatisch verhüllt: Das Unansehnliche ist unbedingt zu vermeiden.
Bereits 14-jährige nebeln sich mit chemischen Duftstoffen ein, um nicht zu “stinken”. Jeder, der es fünf Minuten in die Öffentlichkeit geschafft hat, engagiert sich einen PR-Berater, damit er nicht aus Versehen hässliche Wahrheiten sagt. Das Oberflächendesign ist zur weitaus bedeutendsten Philosophie des Alltagslebens geworden. Und wo die hässliche Fratze des Menschen dann doch unvermeidbar auftaucht, etwa in rassistischen Versammlungen oder korrupten Sportverbänden, da erreicht uns das Monströse nur noch im leuchtenden Rahmen schicker Geräte und eingekleidet mit vernünftigen Kommentaren, so dass zumindest seine wilde Scheußlichkeit immer schon gezähmt auf uns kommt.
Der ästhetische Kompromiss

Geschmacklich enwandfrei: die Frankfurter Frankenallee 2016 (Bild: Christian Eblenkamp)
Für die Ästhetik bedeutet diese Allgegenwart des Anwendbaren eine enorme Abnutzung, für die Anwender einen herrischen Anpassungsdruck. Die Verschönerungs-Präambel als Richtwert für alle Lebensbereiche hebt schleichend, aber wahrnehmbar die normativen Gegensätze von hässlich und erhaben als sich gegenseitig konstituierende Wertmaßstäbe auf. Das Resultat ist eine massive Angleichung im ästhetischen Kompromiss, der bei lautem Geschrei der Vielfalt zu immer weniger Differenz führt. Ob im Autodesign oder beim sportlichen Kleidungsstil, auf den Fernsehkanälen oder in den Shopping-Malls, bei den A-, B- oder C-Prominenten oder im Darstellungsapparat der Politik – das Wahre, Schöne, Gute ist auf einem Niveau angelangt, dass jedes halbwegs hübsche Mädchen bereits zur Marienerscheinung taugt.
Dahinter steht natürlich die Angst der Moderne vor der Ambivalenz, und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass jene Sparte menschlicher Ausdruckskraft, die am beharrlichsten an der Vokabel der “Moderne” klebt, nämlich die Architektur, bei der Nivellierung von Vielfalt in der heutigen Gesellschaft eine Hauptrolle spielt. Abgesehen von der kleinen Versailles-Sparte, in der eine Handvoll internationaler Designkräfte Sonderbauten im Exotenwettkampf stylen dürfen, führt die Krise des Schönen bei der Masse der Gebäudegestalter zu einer global sich ausbreitenden Redundanz der Formen, Skelette, Materialien und Effizienzen. Die Vermeidung des Hässlichen führt zu einer Verschleierung des Schönen in der Rechte-Winkel-Uniform.
Stil als Gesinnung
Genau deswegen ist das übrig gebliebene Hässliche in unseren Städten so erfrischend und inspirierend. Nicht nur hält es die Erinnerung wach an Zeiten vehementer ästhetischer Kämpfe um den richtigen Stil als Ausdruck für die beste Gesinnung. Das zu Große, zu Graue, zu Gleiche, zu Plumpe, zu Massive, zu Ungelenke, das auftrumpfend Farbige, Geformte, Hervorbrüllende und ehemals Selbstbewusste, das die Sechziger, besonders aber die Siebziger und Achtziger uns hinterlassen haben, suggeriert vielmehr eine neue Möglichkeitsform, einen Ausbruch aus dem sedierenden Konsens des guten Geschmacks heutiger Bautätigkeit, der fatal dazu neigt, schon bei der Fertigstellung äußerst banal zu wirken.

Kampfschiffe aus Beton: die Bochumer Uni mit ihrem ausdrucksstarken Audimax (Bild: CanonBen, GFDL oder CC BY SA 3.0)
Ein plastisches Beispiel für diesen Konflikt liefert der Umbau der Ruhr-Universität Bochum. Nach dem Krieg als Utopie eines Gesellschaftswandels vom industriell geprägten Kohlerevier zur Bildungsdemokratie geplant, sind die symbolischen Kampfschiffe aus Beton, die als Kammbauten auf einen Hügel ins Grüne gesetzt wurden, das starke Zeichen der optimistischen Post-Nazi-Moderne. Doch diese fulminante Setzung von Grobschlächtigkeit – die leider bald dunkelgrau wurde wie aller Beton und den schlechten Ruf einer Selbstmörder-Uni erhielt – hat noch heute eine Kraft und Widerborstigkeit, die für das ästhetisch Lauwarme zeittypischer Verwertungs-Strategien untragbar wurde. Und so hat man damit begonnen, unter dem Vorwand bautechnischer Verseuchung die alten Biester abzureißen und sie durch maximal austauschbare Allerweltsarchitektur zu ersetzen, die jeden Charakter ängstlich meidet.
Unter Irrsinnsverdacht
Es sind immer wieder diese beiden Argumente, mit denen die prägnanten “Hässlichkeiten” der Nachkriegszeit zerstört werden – wenn nicht irgendein Denkmalschützer sich dem Verdacht des Irrsinns aussetzen will und störrisch für ihren Erhalt kämpft: bautechnisch nicht mehr zeitgemäß und ästhetisch ein Hemmnis für optimale Verwertbarkeit. In diesem Tenor wurde das Waschbetongebirge des Kröpcke-Centers in Hannover abgerissen, um einem langweiligen hellen Kaufhaustyp mit rundgelutschten Ecken Platz zu machen, wie es ihn mittlerweile in jeder Großstadt in Serie gibt. Die eternit-verkleideten City-Höfe an Hamburgs Hauptbahnhof sollen trotz bestehendem Denkmalschutz und eines vernünftigen Nachnutzungskonzeptes für innerstädtischen Wohnraum gesprengt werden, weil ein Büroneubau der Stadt mehr Geld bringt und der Oberbaudirektor gerne Backsteinarchitektur hätte. Und die Beispiele der hier versammelten Beiträge liefern weiteres Material für den ungeheuer kurzen Gebrauchswert von Bauten der Sechziger bis Achtziger Jahre, deren Substanz auch ganz andere Nutzungen zuließe.

Hannover, Kröpcke-Center: Ein Waschbeton-Gebirge verschwindet hinter austauschbarer Travertin-Ödnis (Bild: Landeshauptstadt Hannover)
Beispiele, wenn auch nur als Interim, gab es in Hamburg mit der Künstlerheimat “Frappant” im leerstehenden Karstadt-Gebäude in Altona, bevor dieses einer neutralen Ikea-Schachtel weichen musste, oder auf der Reeperbahn, wo im Gebäude eines Bowlingcenters von 1958 ab den Neunzigern fast 20 Jahre Clubs und Ateliers für eine legendäre Zeit der Kiez-Kreativität sorgten. Heute stehen hier die Tanzenden Türme von Hadi Teherani mit dem österreichischen Bauriesen Strabag als Hauptmieter. Aber auch die große Zuwanderung von Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen wäre ein vernünftiger Anlass für die Umnutzung von innerstädtischen Gewerbeimmobillien zu Wohnraum, wie sie etwa im riesigen Neckermann-Areal in Frankfurt gerade vorgeprobt wird.
Kulisse des Verfalls
Nun bleiben neben den zugegeben etwas stadtsoziologischen Argumenten für den Erhalt von Großbauten aus der Bonner Republik und dem Verweis auf die praktischen Ansätze, dass die vom Markt ungeliebten Objekte durch kreative Verwandlung neu zu beseelen wären, die ästhetischen und emotionalen Einwände der Hässlichkeit natürlich bestehen. Volkes Stimme, auf die man als Stadtleben-Kommentator mit Vor-Ort-Wissen gerne häufiger hören darf, hat hier meist relativ eindeutige Urteile zu fällen. Fußgängerzonen aus dem Waschbetonzeitalter, Plattenbauten selbst im aufgehübschten Zustand der Nachwendesanierung, kleinstadtgroße Versicherungsbauten in den monofunktionalen “Cities”, die verschlossenen Kaufhäuser der Wirtschaftswunderzeit oder Betonstelen mit Lochfassaden, denen die Witterung jede gutgemeinte Eleganz geraubt hat, können nach der Mehrheit deutscher Leserbriefschreiber sofort weg. Und dort, wo sie von Fernsehregisseuren als Kulisse ins Bild gesetzt werden, dienen sie ausschließlich als defenitive Zeichen für Verfall, Schrecken, Öde und das Unheimliche.
Aber ging es den Gründerzeitbauten nicht vor wenigen Jahrzehnten noch genauso? Als unbrauchbar, antimodern und zu dicht aufeinander geschmäht, wurden die heute mit Abstand beliebtesten städtischen Wohnquartiere großflächig dem Verfall preisgegeben oder abgerissen. Gartenstädte von Architekten, die in böser Kumpanei mit den Nazis bauten und angeblich alle Grundsätze humaner Gesinnung vermissen ließen, sind heute hochbegehrte Idyllen von überzeugender Schönheit. Und erkennen nicht viele Menschen, die heute wieder in den planen weißen Wohnriegeln mit nutzlosem Distanzgrün in die Langeweile des modernen Siedlungslebens mitten in der Stadt gezwungen sind, in den Vorschlägen der einst verspotteten Postmoderne plötzlich echte Qualitäten von Urbanität und Gestaltung?
Ein Ausdruck von Freiheit

Bangkok: Kein Stildiktat des guten Geschmacks (Bild: Tourismuscentre, CC BY SA 4.0)
Vielleicht muss man mal ganz weit weg fliegen, um das fruchtbare Miteinander verschiedener Stilepochen zu verstehen, das eine Metropole von vitaler Gelassenheit und fröhlicher Vielfalt erzeugt. In Bangkok mischen sich bescheidene Hütten mit den unterschiedlichsten Hochhäusern, alte und neue Shopping-Center und kleine goldene Tempel gehen über in gewöhnliche Wohnblöcke mit wuselnden Märkten in scheinbar ungeplanter Abwechslung und Tuchfühlung. Und bei der Architektur gerade der dominanten Hochbauten herrscht keinerlei Stildiktat des guten Geschmacks vor.
Pretty Ugly ist hier ein Gedanke der Freiheit, der vom europäischen Betrachter verlangt, sich von seinem Konsensgefühl des angepassten Stils zu befreien. Pretty Ugly ist aber auch eine Frage des Respekts gegenüber unterschiedlichen Wahrnehmungen und Vorstellungen von Lebenswelt. Vor allem aber ist Pretty Ugly als Urbanitätskonzept ein Gedanke, der Vielfalt und Chance kreiert, der Ambivalenz erzeugt und Nischen, in denen sich unterschiedliche Menschen mit ihren Vorstellungen von Glück in einer Stadt einnisten können.
Das Negativschöne
Das “Negativschöne”, wie der berühmte Hässlichkeitsphilosoph Karl Rosenkranz es Mitte des 19. Jahrhunderts taufte, also die rätselhafte Qualität des Verworfenen, muss von unserer Mainstream-Kultur neu empfunden werden. Und das verlangt als erstes, dass man das Hässliche in unseren Städten so lange aufheben darf, bis man diese Qualität und ihre Nutzbarkeit fähig ist, wiederzusehen – und dann wiederzubeleben.

Titelmotiv: Vielleicht war es in den 1980ern um unseren ästhetischen Gesamtzustand besser bestellt: Berlin, Friedrichstadtpalast (Bild: Michael Fötsch, CC BY SA 2.0)
Download
Inhalt

LEITARTIKEL: Hübsch hässlich
Till Briegleb sinniert über Schönheit, Geschmack und glattgebügelten Zeitgeist.

FACHBEITRAG: Unter der Laterne
Karin Berkemann staunt über einen opulenten 80er-Jahre-Bau in Langen: die katholische Albertus-Magnus-Kirche von Johannes W. M. Kepser.
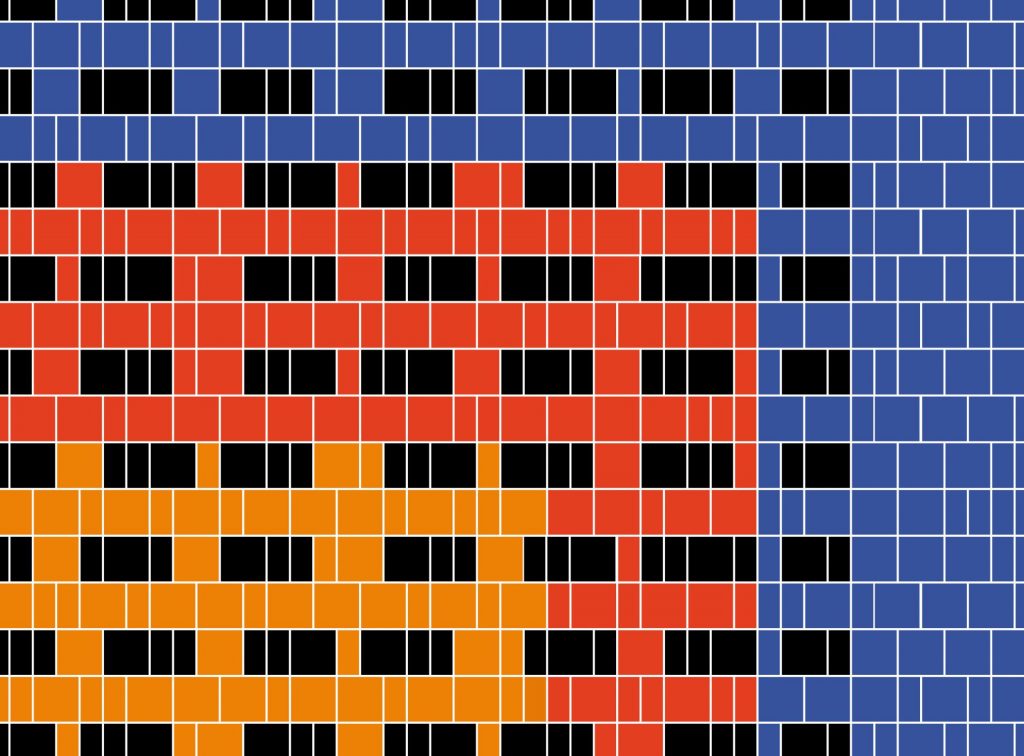
FACHBEITRAG: Früher war mehr bunt
Uta Winterhager berichtet über zwei farbenfrohe 70er-Jahre-Hochhäuser in Köln: das Herkuleshaus und die Doppeltürme der Deutschen Welle.

FACHBEITRAG: Schon schön
Karin Hartmann untersucht die Königsplätze von Paderborn (1969-81) und ihre Chancen, wieder zu einem echten Treff- und Mittelpunkt zu werden.

FACHBEITRAG: Post-bürgerlich
Christian Holl betritt den postmodernsten Straßenzug der Mainmetropole, deren Römer gerade wieder der nächsten Rekonstruktion entgegensieht.

FOTOSTRECKE: Habiflex
Jan Kampshoff belichtet ein gescheitertes Zukunftsprojekt: In Dorsten findet sich im Stadtteil Wulfen das Habiflex.

INTERVIEW: Ursulina Schüler-Witte zum Bierpinsel
moderneREGIONAL sprach mit der Architektin über das Turmrestaurant Steglitz, in Berlin besser bekannt als “Bierpinsel”.

PORTRÄT: Gute Bausünden
Turit Fröbe fotografiert Bausünden in ganz Deutschland. Und entdeckt doch immer wieder die Qualitäten der kritisierten Bauwerke.
